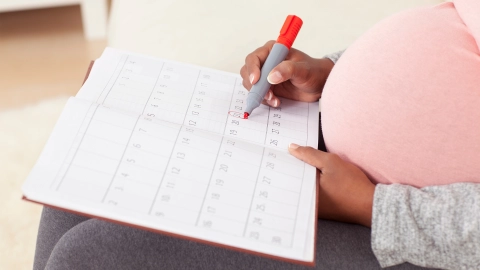Gesund leben Finanzielle Leistungen rund um Schwangerschaft und Geburt
Schwangere und stillende Frauen in einem Beschäftigungsverhältnis sind im Rahmen des Mutterschutzes besonders geschützt. Verschiedene finanzielle Leistungen erleichtern den Start ins Familienleben. Bei geringem Einkommen sind zusätzliche Leistungen möglich – auch schon in der Schwangerschaft.
Auf einen Blick
- Für alle beschäftigten Frauen, die schwanger sind oder stillen, gilt der Mutterschutz – unabhängig von der Art der Beschäftigung.
- Der Mutterschutz umfasst einen besonderen Schutz vor Kündigung und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Er beinhaltet außerdem Mutterschaftsleistungen, die fehlendes Einkommen ausgleichen sollen.
- Während der Mutterschutzfristen dürfen Frauen für gewöhnlich nicht arbeiten – also ab 6 Wochen vor dem berechneten Entbindungstermin bis in der Regel 8 Wochen nach der Geburt.
- Bereits in der Schwangerschaft können Eltern den Antrag auf Elterngeld vorbereiten.
- Nach der Geburt können Eltern Kindergeld beantragen. Das geht auch bis zu 6 Monate rückwirkend.
- Bei geringem oder fehlendem Einkommen sind weitere finanzielle Leistungen möglich.

Einleitung
Die Geburt eines Kindes ist in der Regel ein schönes Ereignis für die werdenden Eltern. Um die Gesundheit von Mutter und Kind nicht zu gefährden, sind schwangere und stillende Frauen in einem Beschäftigungsverhältnis besonders geschützt – dies wird durch den Mutterschutz geregelt. Verschiedene Mutterschaftsleistungen sollen außerdem sicherstellen, dass Frauen durch die Geburt eines Kindes finanziell nicht benachteiligt sind.
Nach der Geburt erhalten Eltern neben praktischen Unterstützungsangeboten auch unterschiedliche Familienleistungen wie Elterngeld oder Kindergeld zur finanziellen Unterstützung. Es ist sinnvoll, sich dazu schon in der Schwangerschaft zu informieren, da einiges bereits vor der Geburt vorbereitet werden kann. Für Familien mit geringem oder ohne Einkommen gibt es neben den gängigen Familien- und Sozialleistungen weitere finanzielle Hilfen – auch schon in der Schwangerschaft. Näheres zu den verschiedenen Leistungen erfahren Sie in diesem Artikel.
Da rund um die Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes viele Formalitäten anstehen, kann man leicht den Überblick verlieren. Das Familienportal des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend bietet hilfreiche Checklisten für die Zeit vor und nach der Geburt.
Was ist Mutterschutz und für wen gilt er?
Der Mutterschutz soll Frauen, die schwanger sind oder ein Kind stillen und in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, besonders schützen. Das Mutterschutz-Gesetz bildet hierfür die gesetzliche Grundlage.
Der Mutterschutz gilt für alle schwangeren und stillenden Beschäftigten. Es ist also egal, ob man in Teilzeit arbeitet, nur geringfügig beschäftigt ist oder gerade einen Bundesfreiwilligendienst macht.
Mutterschutz umfasst:
- den Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz
- einen besonderen Kündigungsschutz
- ein Beschäftigungsverbot in den Wochen vor und nach der Geburt (Mutterschutzfrist)
- Mutterschaftsleistungen während des Beschäftigungsverbots
Gut zu wissen: Mutterschutz gibt es auch für schwangere und stillende Frauen, die gerade ein Praktikum machen, das für ihre berufliche Ausbildung notwendig ist. Auch während einer beruflichen Ausbildung greift der Mutterschutz, insofern die Ausbildung auf einem Arbeitsvertrag beruht. Mutterschutz gibt es mit einigen Besonderheiten auch für Studentinnen und Schülerinnen.
Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz
Schwangere und stillende Frauen dürfen nicht arbeiten, wenn sie oder das Kind dadurch gefährdet sind. Beispielsweise dürfen schwangere und stillende Frauen nicht mit gesundheitsgefährdenden Stoffen arbeiten oder regelmäßig schwer heben. Sie dürfen außerdem nicht nachts und an Sonntagen oder Feiertagen beschäftigt werden – es sei denn, die Frau selbst wünscht dies ausdrücklich.
Bei einer möglichen Gefährdung muss die Arbeitgeberin beziehungsweise der Arbeitgeber zunächst schauen, ob sich die Arbeitsbedingungen anpassen lassen. Auch eine Versetzung an einen anderen Arbeitsplatz ist möglich. Kann eine mögliche Gefährdung von Mutter und Kind auf diese Weise nicht abgewendet werden, dann muss der Arbeitgeber ein Beschäftigungsverbot aussprechen. Dieses sogenannte „betriebliche Beschäftigungsverbot“ hat im Unterschied zum „ärztlichen Beschäftigungsverbot“ nichts mit dem Gesundheitszustand von Mutter oder Kind zu tun.
Weiterführende Informationen zu den verschiedenen Arten von Beschäftigungsverboten in der Schwangerschaft bietet das Familienportal des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Besonderer Kündigungsschutz
Während des Mutterschutzes gilt ein besonderer Kündigungsschutz. Die Arbeitgeberin beziehungsweise der Arbeitgeber darf in dieser Zeit der Frau in der Regel nicht kündigen. Eine Kündigung ist nur in wenigen Ausnahmen zulässig, zum Beispiel wenn das Unternehmen insolvent ist.
Der Kündigungsschutz greift erst, sobald der Arbeitgeber von der Schwangerschaft oder Geburt weiß. Wurde ohne dieses Wissen bereits eine Kündigung ausgesprochen, hat die Frau noch zwei Wochen Zeit, um den Arbeitgeber über ihre Schwangerschaft zu informieren.
Mutterschutzfrist
Während der sogenannten „Mutterschutzfrist“ dürfen Frauen nicht arbeiten. Umgangssprachlich sagt man dann auch, dass eine Frau im „Mutterschutz“ ist.
Die Mutterschutzfrist beginnt in der Regel 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin und endet normalerweise 8 Wochen nach der Geburt. Kommt das Kind vor dem errechneten Geburtstermin zur Welt, dann endet die Mutterschutzfrist erst 8 Wochen nach dem errechneten Termin. Die Frist nach der Geburt dauert dann also nicht 8 Wochen, sondern ein paar Tage länger. Bei Frühchen oder nach Geburt mehrerer Kinder endet die Mutterschutzfrist erst 12 Wochen nach Geburt.
Die Mutterschutzfristen gelten für alle Frauen rund um die Geburt eines Kindes. Möchte eine Frau in den Wochen vor der Geburt noch arbeiten, so kann sie dies auf eigenen Wunsch. Verlangen darf ein Arbeitgeber dies jedoch nicht. In den Wochen nach der Geburt gilt ein absolutes Beschäftigungsverbot: In dieser Zeit dürfen Frauen zum eigenen Schutz und zum Schutz des Kindes nicht arbeiten.
Auch bei einer Fehlgeburt nach der 13. Schwangerschaftswoche haben Frauen Anspruch auf Mutterschutz. Seit dem 1. Juni 2025 gelten neue Regelungen – Frauen haben seither Anspruch auf:
- bis zu 2 Wochen Mutterschutz bei einer Fehlgeburt ab der 13. Schwangerschaftswoche
- bis zu 6 Wochen Mutterschutz bei einer Fehlgeburt ab der 17. Schwangerschaftswoche
- bis zu 8 Wochen Mutterschutz bei einer Fehlgeburt ab der 20. Schwangerschaftswoche
Während der Schutzfrist nach einer Fehlgeburt dürfen Frauen nicht arbeiten, es sei denn, sie wünschen dies selbst. Sie haben in dieser Zeit außerdem Anspruch auf Mutterschaftsleistungen.
Ausführliche Informationen dazu, für wen Mutterschutz gilt und welche Regelungen im Einzelnen gelten, bietet das Familienportal des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Der Leitfaden zum Mutterschutz des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend informiert ausführlich zu allen Fragen rund um den Mutterschutz.
Welche finanziellen Leistungen erhalte ich im Mutterschutz?
Welche Mutterschaftsleistungen Sie bekommen können, hängt ab:
- von Ihrer Arbeitssituation
- von Ihrer Krankenversicherung
- davon, ob Sie sich in den Mutterschutzfristen befinden oder nicht
Während der Mutterschutzfristen erhalten:
- gesetzlich versicherte Frauen weiterhin ihr vorheriges Gehalt. Dieses wird zum Teil vom Arbeitgeber („Arbeitgeberzuschuss“) und zum Teil von der Krankenkasse gezahlt („Mutterschaftsgeld“).
- privat versicherte Frauen Mutterschaftsgeld vom Bundesamt für Soziale Sicherung. Dies gilt auch für Frauen, die bei einer gesetzlichen Krankenkasse beitragsfrei familienversichert sind. Inwieweit das Gehalt in dieser Zeit weitergezahlt wird, hängt von der Art der Beschäftigung ab – also beispielsweise, ob man selbstständig oder angestellt ist.
Privat versicherte Frauen erhalten außerdem unter Umständen Krankentagegeld, wenn sie eine entsprechende Versicherung abgeschlossen haben.
Wichtig zu wissen: Sie müssen Mutterschaftsgeld selbst bei der Krankenkasse beziehungsweise beim Bundesamt für Soziale Sicherung beantragen. Hierfür benötigen Sie die Bescheinigung über den voraussichtlichen Entbindungstermin. Den Antrag sollten Sie spätestens 7 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin einreichen.
Wenn Sie privat versichert oder beitragsfrei gesetzlich familienversichert sind, können Sie den Antrag auf Mutterschaftsgeld direkt online beim Bundesamt für Soziale Sicherung stellen. Dort finden Sie auch die Antragsunterlagen zum Ausdrucken, falls Sie den Antrag per Post verschicken möchten.
Weitere Informationen zu Mutterschaftsleistungen finden Sie auf dem Familienportal des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Was ist Elterngeld?
Das Elterngeld bietet Eltern eine finanzielle Unterstützung, wenn sie ihr Kind betreuen und dadurch weniger oder nicht arbeiten. Auch wenn man vor der Geburt kein Einkommen hatte, kann man einen Mindestbetrag an Elterngeld erhalten.
Es gibt verschiedene Varianten von Elterngeld: Basiselterngeld, ElterngeldPlus und Partnerschaftsbonus. Basiselterngeld steht beiden Eltern zusammen insgesamt 14 Monate zu. ElterngeldPlus kann man doppelt so lange erhalten wie Basiselterngeld. Dafür ist das ElterngeldPlus in der Regel nur halb so hoch. Mit dem Partnerschaftsbonus kann man den Bezug von Elterngeld um einige Monate verlängern, wenn in dieser Zeit beide Elternteile in Teilzeit arbeiten.
Das Basiselterngeld beträgt monatlich zwischen 300 und 1.800 Euro; das ElterngeldPlus zwischen 150 und 900 Euro monatlich (Stand 2025). Wie viel Elterngeld man bekommt, hängt unter anderem davon ab:
- wie viel Einkommen man bisher hatte
- wie viel Einkommen man haben wird, während man Elterngeld bekommt
- ob man noch andere staatliche Leistungen erhält
- welche Variante von Elterngeld man wählt
- ob es sich um eine Zwillings- oder Mehrlingsschwangerschaft handelt
- ob man bereits Kinder hat
Ein Beispiel: Eine Frau hatte vor der Geburt ihres Kindes ein regelmäßiges Netto-Einkommen von 2.000 Euro aus einem Angestelltenverhältnis. Sie plant, während der Elternzeit nicht arbeiten zu gehen. In den ersten 8 Wochen nach der Geburt erhält sie pro Tag 13 Euro Mutterschaftsgeld von ihrer Krankenkasse. Ihr Arbeitgeber zahlt in dieser Zeit zusätzlich die Differenz zu ihrem bisherigen Netto-Gehalt („Arbeitgeberzuschuss“). Anschließend bekommt sie für 10 Monate 1.300 Euro Basiselterngeld. Das entspricht 65 Prozent ihres bisherigen Gehalts. Möglich wäre auch, dass sie für insgesamt 22 Monate ElterngeldPlus in Höhe von 650 Euro pro Monat bezieht.
Mit dem Elterngeldrechner des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMBFSFJ) können Sie herausfinden, wie viel Elterngeld Sie theoretisch erhalten.
Das Familienportal des BMBFSFJ bietet außerdem ausführliche Informationen zum Thema Elterngeld. Sie können über das Portal außerdem nach einer Beratungsstelle in Ihrer Nähe suchen.
Unter elterngeld-digital.de finden Sie ebenfalls Antworten auf häufige Fragen zum Elterngeld. Sie können dort zudem Elterngeld direkt online beantragen.
Was sollte man zum Kindergeld wissen?
Kindergeld soll die grundlegende Versorgung von Kindern ab der Geburt bis mindestens zu deren 18. Lebensjahr sicherstellen. Es beträgt monatlich 255 Euro für jedes Kind (Stand 2025).
Sie können Kindergeld nach der Geburt Ihres Kindes bei der Bundesagentur für Arbeit beantragen. Für den Antrag benötigen Sie die Geburtsurkunde und die steuerliche Identifikationsnummer Ihres Kindes. In der Regel erhalten Sie mehrere kostenfreie Ausfertigungen der Geburtsurkunde, zwei davon für die Beantragung von Kindergeld und Elterngeld. Falls Sie den Antrag auf Kindergeld zunächst vergessen haben, ist das nicht schlimm: Kindergeld wird ab der Antragsstellung bis zu 6 Monate rückwirkend ausgezahlt.
Auf dem Familienportal des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend finden Sie ausführliche Informationen zum Thema Kindergeld.
Bei der Bundesagentur für Arbeit können Sie Kindergeld direkt online beantragen.
Welche weiteren Unterstützungsmöglichkeiten gibt es für Familien mit geringem oder ohne Einkommen?
Neben Familienleistungen wie Mutterschaftsgeld, Elterngeld und Kindergeld können schwangere Frauen beziehungsweise Familien bei Bedarf verschiedene allgemeine Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe und Wohngeld beziehen. Darüber hinaus gibt es weitere finanzielle Hilfen speziell für Familien.
Wenn Sie ein geringes Einkommen haben, kann es sich lohnen, Ihren Anspruch auf Wohngeld zu überprüfen. Das ist zum Beispiel möglich mit dem Wohngeld-Plus-Rechner des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen.
Was ist der Kinderzuschlag?
Der Kinderzuschlag ist eine staatliche Geldleistung. Den Zuschlag können Familien erhalten, bei denen das Einkommen nicht für die gesamte Familie reicht. Er wird zusätzlich zum Kindergeld ausgezahlt und muss gesondert bei der Familienkasse beantragt werden.
Ausführliche Informationen zum Thema Kinderzuschlag finden Sie auf dem Familienportal des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Ob Sie Anspruch auf einen Kinderzuschlag haben, können Sie mit dem KiZ-Lotsen der Bundesagentur für Arbeit ermitteln. Dort können Sie außerdem den Kinderzuschlag online beantragen.
Welche weiteren Hilfen gibt es bei geringem Einkommen?
Schon vor der Geburt eines Kindes kommen auf werdende Eltern einige Ausgaben zu, etwa für Umstands- und Babykleidung oder einen Kinderwagen. Deshalb können Schwangere zusätzliches Geld bekommen, wenn sie Sozialhilfe oder Bürgergeld beziehen oder wenig verdienen. Die werdende Mutter kann beispielsweise einen sogenannten Mehrbedarfs-Zuschlag zu ihrer bestehenden Leistung erhalten. Darüber hinaus sind auch einmalige Leistungen möglich, zum Beispiel für die Erstausstattung des Kindes.
Wenn Sie mehr zu besonderen Leistungen für Schwangere mit geringem Einkommen erfahren möchten, können Sie sich an das zuständige Jobcenter wenden.
Schwangere Frauen können außerdem durch die „Bundesstiftung Mutter und Kind“ finanziell unterstützt werden. Das gilt für Frauen, deren Einkommen während der Schwangerschaft, Geburt und in der Zeit danach nicht ausreicht und bei denen andere staatliche Leistungen nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen.
Wichtig zu wissen: Den Antrag auf eine finanzielle Unterstützung durch die „Bundesstiftung Mutter und Kind“ muss man vor der Geburt stellen. Spätere Anträge werden nicht berücksichtigt. Eine Antragsstellung ist bei einer örtlichen Schwangerschafts-Beratungsstelle möglich.
Ausführliche Informationen finden Sie auf der Webseite der „Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“.
Alleinerziehende oder verwitwete Elternteile können außerdem einen Unterhaltsvorschuss beantragen. Der Unterhaltsvorschuss unterstützt Alleinerziehende, wenn der andere Elternteil keinen oder nur unregelmäßig Unterhalt zahlt. Man kann den Vorschuss zudem bekommen, wenn der andere Elternteil zwar etwas zahlt, aber weniger als den festgelegten Mindestunterhalt. Einen Unterhaltsvorschuss kann man auch beantragen, wenn nicht geklärt ist, wer der Vater des Kindes ist.
Näheres zum Unterhaltsvorschuss sowie zu dessen Beantragung erfahren Sie auf dem Familienportal des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Wo finde ich Beratung und Hilfe?
Bundesweit finden Sie bei zahlreichen Schwangerschafts-Beratungsstellen sowie Familien- und Erziehungsberatungsstellen von verschiedenen Trägern kostenlos Unterstützung.
Schwangerschafts-Beratungsstellen in Ihrer Nähe finden Sie auf der Webseite familienplanung.de des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit.
Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. bietet ebenfalls eine umfassende Suche nach Beratungsstellen. Bei der Suche kann man nach verschiedenen Schwerpunkten wie Familienberatung oder Schwangerenberatung filtern.
Eine Liste mit Beratungsangeboten zu verschiedenen Themen im ersten Lebensjahr bietet das Netzwerk Gesund ins Leben.
Beratungsstellen vor Ort sowie den richtigen Ansprechpartner bei finanziellen Leistungen wie Elterngeld oder Kinderzuschlag finden Sie auch auf dem Familienportal des Bundesministeriums für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Schwangere Frauen können sich rund um die Uhr kostenfrei und anonym an das Hilfetelefon Schwangere in Not wenden.
Telefonnummer: 0800 40 40 020
Fühlen Sie sich mit Ihrem Kind überfordert oder hilflos, steht auch das Elterntelefon der Nummer gegen Kummer zur Verfügung. Die Beratung erfolgt anonym und kostenlos.
Montag, Mittwoch und Freitag: 9 bis 17 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 9 bis 19 Uhr
Telefonnummer: 0800 111 0 550
Wenn Sie psychische Probleme haben oder in einer Krise stecken, können Sie sich kostenfrei und rund um die Uhr an die Telefonseelsorge wenden.
Telefonnummer: 116 123
E-Mail- und Chatseelsorge: online.telefonseelsorge.de
- Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bundesstiftung Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens. Wer kann Hilfe beantragen. Aufgerufen am 18.08.2025.
- Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Familienportal. Elterngeld. Aufgerufen am 18.08.2025.
- Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Familienportal. Kindergeld. Aufgerufen am 18.08.2025.
- Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Familienportal. Mutterschutz. Aufgerufen am 18.08.2025.
- Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Familienportal. Unterhaltsvorschuss. Aufgerufen am 18.08.2025.
- Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Familienportal. Staatliche Leistungen in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Aufgerufen am 18.08.2025.
- Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Familienportal. Was sind Mutterschaftsleistungen, Mutterschutzlohn und Mutterschaftsgeld? Aufgerufen am 18.08.2025.
- Bundesministerium für Justiz. Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium (Mutterschutzgesetz - MuSchG). Stand: 24.02.2025.
Geprüft durch die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. (VZ NRW).
Stand: